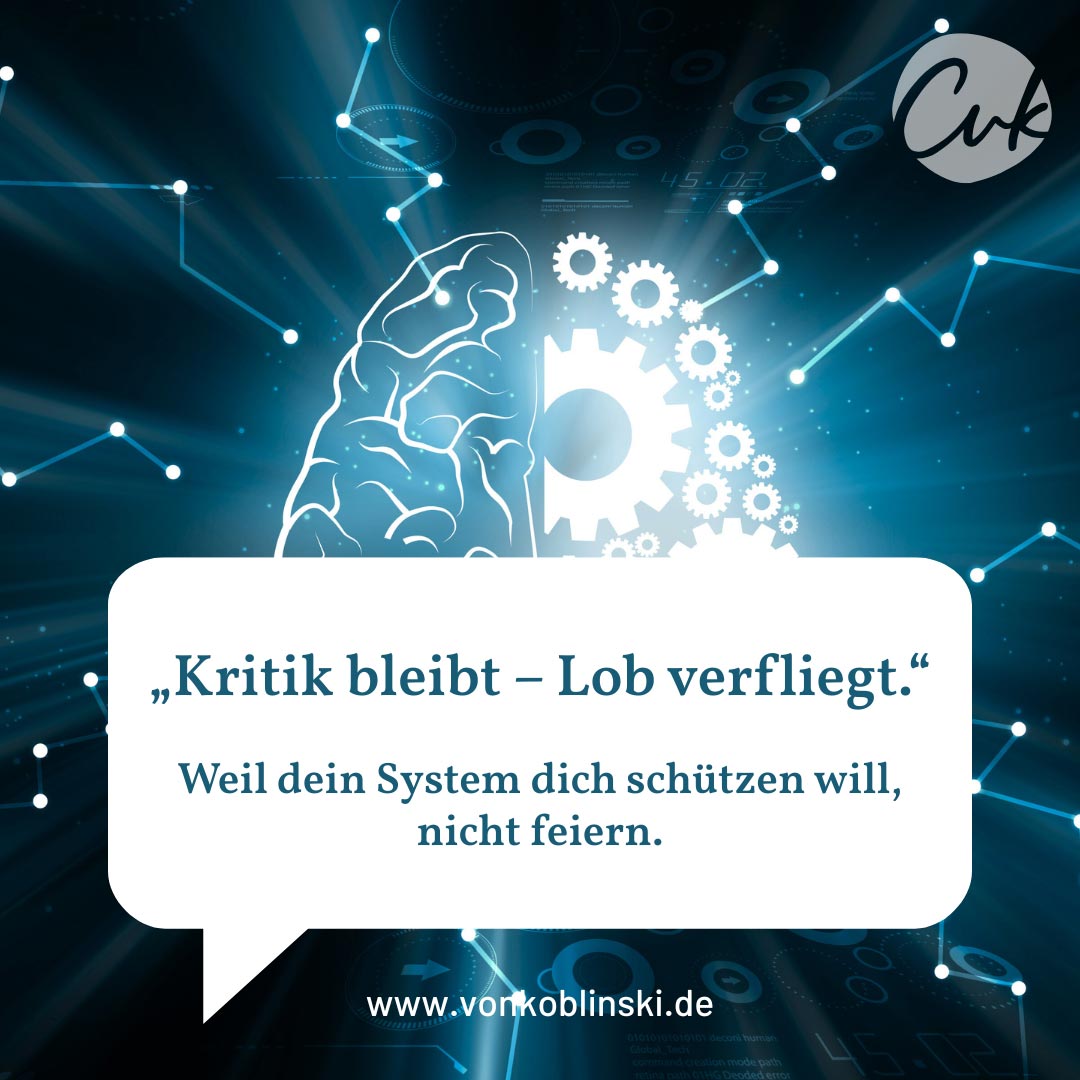Manchmal genügt ein einziger Satz und er bleibt hängen.
„Das war aber schwach von dir.“
Und zack … Jahre später erinnerst du dich noch genau an den Tonfall.
Doch ein ehrliches Lob?
Verblasst oft schon nach ein paar Tagen.
Warum ist das so?
Unser Gehirn ist auf Schutz ausgelegt, aber fähig zu viel mehr
Das menschliche Gehirn ist ein wahres Multitalent!
Es denkt, erinnert, fühlt, plant und lernt ein Leben lang dazu.
Sein ältester Auftrag aber ist: Überleben sichern. Darum achtet es besonders auf das, was bedrohlich oder unangenehm sein könnte.
Psychologen nennen das den Negativitätsbias. Der Sozialpsychologe Roy F. Baumeister und sein Team zeigten 2001 in einer Metaanalyse (Review of General Psychology), dass negative Erlebnisse im Gehirn etwa fünfmal stärker wirken als positive.
Das erklärt, warum ein unfreundlicher Kunde uns den Tag verderben kann, auch wenn neun davor freundlich waren.
Unser Gehirn will uns nicht kleinhalten, es will uns sicher halten. Und genau darin liegt der Schlüssel zu bewusster Selbstführung.
Warum Worte manchmal weh tun wie Wunden
Neurowissenschaftliche Studien (u. a. Naomi Eisenberger & Matthew Lieberman, UCLA, 2003) zeigen, dass emotionaler Schmerz dieselben Hirnregionen aktiviert wie körperlicher Schmerz, vor allem die Amygdala (unser emotionales Warnsystem) und den anterioren cingulären Cortex, der an der Schmerzverarbeitung beteiligt ist.
Mit anderen Worten:
Das Gehirn unterscheidet kaum zwischen „jemand verletzt mich mit Worten“ und „ich stoße mir das Schienbein“. Beides löst Stress- und Schutzreaktionen aus.
Darum kann ein abfälliger Kommentar lange nachhallen, während Lob oft so schnell verfliegt wie der Duft von frischem Kaffee.
Gute Nachrichten: Das Gehirn lässt sich verändern
Die moderne Neurowissenschaft hat eine beruhigende Botschaft:
Unser Gehirn bleibt formbar – ein Leben lang.
Dank der sogenannten Neuroplastizität können sich neuronale Verbindungen durch Erfahrung und Übung verändern.
Das bedeutet:
Wir können lernen, positive Erfahrungen stärker zu verankern als negative.
Studien zeigen zum Beispiel:
- Dankbarkeitspraxis aktiviert Hirnareale im Präfrontalkortex, die mit Zufriedenheit und sozialem Vertrauen verbunden sind
(Emmons & McCullough, Journal of Personality and Social Psychology, 2003). - Achtsamkeit reduziert die Aktivität der Amygdala und stärkt die Selbstregulation
(Hölzel et al., Proceedings of the National Academy of Sciences, 2011). - Selbstmitgefühl und positive Selbstgespräche aktivieren das Belohnungssystem im Striatum und erhöhen das Wohlbefinden
(Longe et al., Social Cognitive and Affective Neuroscience, 2010).
Kurz gesagt:
Unser Gehirn kann lernen, Komplimente länger zu speichern als Kränkungen, wenn wir es regelmäßig daran erinnern.
Vier einfache Wege, dein Gehirn neu zu trainieren
- Notiere drei Dinge, die gut waren.
Dein Gehirn merkt sich, worauf du es regelmäßig lenkst. - Atme Komplimente ein.
Statt sie abzuwehren („Ach, war doch nichts“), kurz innehalten,
bewusst wahrnehmen, annehmen. - Rede freundlich mit dir selbst.
Der Ton in deinem Kopf prägt deine innere Haltung.
Wer sich ständig kritisiert, hält sein Nervensystem im Stressmodus. - Betrachte Kritik als Information, nicht als Urteil.
Nicht jeder Kommentar ist eine Bewertung deiner Person.
Manchmal ist es einfach ein Hinweis – nicht mehr, nicht weniger.
Fazit: Dein System hält dich am Leben – nicht glücklich oder gesund
Wenn dich alte Sätze noch heute beschäftigen, hat das nichts mit Empfindlichkeit zu tun.
Dein System ist auf Überleben ausgelegt. Es speichert, was einmal schmerzhaft war, nicht um dich zu bestrafen, sondern um dich künftig zu schützen.
Das Problem:
In einer Welt, in der selten echte Gefahr droht, reagiert dein Körper noch immer so, als wäre sie da. Doch Sicherheit entsteht heute anders als früher – durch Vertrauen, Wertschätzung und innere Ruhe. Sprich freundlich mit dir.
Reflexionsfrage zum Schluss
Wann hast du das letzte Mal ein Kompliment wirklich angenommen – so, dass du es fühlen konntest? Vielleicht ist heute ein guter Tag, damit anzufangen.
Fachliche Quellen (vereinfacht dargestellt)
- Baumeister, R. F. et al. (2001). Bad is stronger than good. Review of General Psychology, 5(4), 323–370.
- Eisenberger, N. I., & Lieberman, M. D. (2003). Does rejection hurt? Science, 302(5643), 290–292.
- Emmons, R. A., & McCullough, M. E. (2003). Counting blessings versus burdens. Journal of Personality and Social Psychology, 84(2), 377–389.
- Hölzel, B. K. et al. (2011). Mindfulness practice leads to increases in regional brain gray matter density. PNAS, 108(7), 16530–16535.*
- Longe, O. et al. (2010). Having a word with yourself: Neural correlates of self-reflection and self-criticism. Social Cognitive and Affective Neuroscience, 5(3), 264–272.*